Rosenthal Studio Line
Rosenthal GmbH, 1879 in Selb (Bayern) gegründet, hat sich über mehr als vier Generationen hinweg zu einem der führenden Hersteller für Porzellan- und Glasdesign weltweit entwickelt. 1961 nahm die Marke Rosenthal studio-line ihren Anfang: Unter der Leitung von Philip Rosenthal wurde eine eigenständige, designorientierte Produktlinie geschaffen, die sich bewusst an avantgardistische Gestalter und moderne Wohnästhetik richtete.
Bereits 1960, ein Jahr vor dem offiziellen Start, eröffnete das erste „Studiohaus“ in Nürnberg als Ausstellungsraum für die jungen, visionären Entwürfe und setzte damit neue Maßstäbe im Direktvertrieb und in der Markenpräsentation.
Entwicklung & Expansion
Von Beginn an verstand sich studio-line als Wirtschafts- und Kreativmotor zugleich: Innerhalb der ersten fünf Jahre kamen Standorte in Berlin, München und Frankfurt hinzu. Bereits 1965 erzielten die Studiohäuser einen kumulierten Jahresumsatz von mehr als 10 Mio. DM.
Durch diese Vertriebsarchitektur wuchs die Markenbekanntheit in der Bundesrepublik rasch, während gleichzeitig internationale Ausstellungen in Mailand und New York die globale Strahlkraft der Marke unterstrichen.
Gestaltung & Kooperationen
Bis heute kooperierte Rosenthal studio-line mit über 150 renommierten Künstlern und Designern – darunter Ikonen wie Raymond Loewy, Walter Gropius, Tapio Wirkkala und contemporäre Gestalter wie Sebastian Herkner. Diese Kooperationen führten zu mehr als 500 nationalen und internationalen Designpreisen, die in Museen und privaten Sammlungen weltweit vertreten sind.
Die typische Kennzeichnung jedes Porzellanstücks ist der Unterglasurbasisstempel mit dem Schriftzug „Rosenthal“ und dem Zusatz „studio-line“, der seit 1961 verpflichtend ist und heute als Qualitäts- und Herkunftssiegel gilt.
Sortiment & Produktion
Das Sortiment von studio-line umfasst moderne Tischkultur, Vasen, Leuchten und limitierte Editionen. Aktuell befinden sich über 200 verschiedene Modelle im Katalog, die in über 60 Ländern vertrieben werden. Mit rund 800 Mitarbeitenden (Stand 2019) sichert die Produktlinie Arbeitsplätze in Produktion, Design und Vertrieb und trägt maßgeblich zur regionalen Wirtschaft im Fichtelgebirge bei.
2009 wurde Rosenthal Teil der italienischen Sambonet Paderno Industrie (Arcturus Group), blieb jedoch in seiner Markenidentität und Designphilosophie eigenständig. 2021 feierte studio-line sein 60-jähriges Bestehen mit Sondereditionen und einer Jubiläumsausstellung in Selb, die von mehr als 5.000 Besuchern binnen zwei Wochen wahrgenommen wurde.
Design-Ikonen & Künstlereditionen
Lotus – Bjørn Wiinblad
Die Form Lotus entwickelt ihren Formgedanken aus dem Motiv des Lotusblattes. Klare geometrische Grundelemente verbinden sich mit pflanzenhaften Anklängen. Charakteristisch ist das umlaufende Flachrelief mit Blattsilhouetten. Die Form Lotus erhielt 1967 die Auszeichnung „Die gute Industrieform“.
Duo – Ambrogio Pozzi
Die Form Duo basiert auf elementaren Hohlformen – Zylinder, Halbkugeln und Scheiben. Der Aufbau folgt dem Prinzip „Weniger ist mehr“ (Mies van der Rohe) und überzeugt durch Eleganz, Gebrauchstüchtigkeit und Stapelbarkeit. 1968 erhielt Duo die Goldmedaille des Präsidenten der Republik beim „Concorso Internationale della Ceramica“ in Faenza.
Berlin – H. T. Baumann
Die Form Berlin zeichnet sich durch eine zylindrische Silhouette mit betonter Höhentendenz aus. Öffnende Gestaltungselemente verleihen den Gefäßen eine skulpturale Wirkung. Die Tassen- und Kannenhenkel sind funktional und klassisch proportioniert – ein Beispiel für funktionales Design.
Künstlerteller studio-line
Die Edition der Künstler-Teller brachte internationale Künstler wie Günter Grass, Salvador Dalí und Yehudi Menuhin auf Porzellan. Limitierte Auflage (5.000 nummerierte und signierte Exemplare) machte die Teller zu begehrten Sammlerobjekten. Sie stehen beispielhaft für die Idee: „Mit Kunst leben“.
Gruppe 21
Die Gruppe 21 umfasst Kollektionen hervorragender europäischer Hersteller, die in Rosenthal Studio-Abteilungen präsentiert wurden. Eine Jury unabhängiger Kunstkritiker garantierte die künstlerische Qualität. Studio-Häuser und -Abteilungen boten so ein kuratiertes Angebot für zeitgenössische Tischkultur.
Bjørn Wiinblad
Bjørn Wiinblad begann 1957 die Zusammenarbeit mit Rosenthal. 1918 in Kopenhagen geboren, schuf er im Werk Bahnhof Selb u. a. die legendäre Form Zauberflöte und zahlreiche weitere Entwürfe, bevor die Produktion ins Werk Rotbühl verlagert wurde.
Fazit & Bedeutung
Heute gilt Rosenthal studio-line als Synonym für die Verschmelzung von traditioneller Handwerkskunst und zeitgenössischem Design. Durch die konsequente Zusammenarbeit mit internationalen Kreativen, die Pflege von Manufakturtechniken und die Expansion in Schlüsselmärkte bleibt studio-line ein Impulsgeber – nicht nur für Porzellangestaltung, sondern für moderne Wohnkultur insgesamt.
Rosenthal Studio-Line – „Kunst im Alltag“ seit 1961
Die Studio-Line verbindet seit 1961 internationale Kunst und Design mit industrieller Porzellanproduktion: Service-Ikonen, limitierte Kunstobjekte und Wand-/Reliefwerke, die bis heute Maßstäbe setzen.
Timeline – Meilensteine der Studio-Line
- 1960 – Erstes Rosenthal Studio-Haus (Nürnberg) – kuratierte Präsentation moderner Tischkultur.
- 1961 – Gründung Rosenthal Studio-Line – „Kunst im Alltag“ als Programm.
- 1969 – Start der limitierten Kunstreihen (nummerierte Editionen, Zertifikate, Signaturen).
- 1970er – Ausbau internationaler Kooperationen (u. a. Vasarely, Dalí, Hundertwasser, Fuchs, Wiinblad).
- 1976 – Timo Sarpaneva: Form Suomi – vielfach prämierter Studio-Line-Klassiker.
- 1980er – Weltweites Netz von Studio-Häusern; Studio-Line prägt Sammler- und Alltagskultur.
- Heute – Studio-Line-Formen und limitierte Objekte bleiben Referenz – Service-Ikonen, Wandobjekte, Reliefs.
Künstler & Designer der Studio-Line (Auswahl)
Timo Sarpaneva
Form Suomi (1976) – weiche Kiesel-Anmutung, hohe Gebrauchstauglichkeit; Service-Ikone.
Tapio Wirkkala
Tea for Two – klare Linien und skulpturale Ruhe; ergonomisch, zeitlos.
Walter Gropius
Form TAC (The Architects Cup) – Bauhaus-Prinzip in Porzellan, architektonisch klar.
Björn Wiinblad
Fantasievolle Dekor- und Objektentwürfe (u. a. Zauberflöte) mit hoher Wiedererkennbarkeit.
Victor Vasarely
Op-Art-Übertragungen als Wand-/Objektporzellan, später auch Objektvasen; limitierte Kunstobjekte.
Salvador Dalí
Surreale Wandobjekte, Teller, Objekte in nummerierten Auflagen; begehrt am Sammlermarkt.
F. Hundertwasser · E. Fuchs · O. Alt
Limitierte Objekte, Wandbilder, Teller – starke Handschriften, editionsgebunden.
Raymond Loewy
Industriedesign-Ikone – klare, markenprägende Formensprachen (z. B. Rendezvous).
Service-Ikonen
- Suomi (Sarpaneva, 1976)
- Tea for Two (Wirkkala)
- TAC (Gropius)
Limitierte Kunstreihen
- Nummerierte Auflagen (Zertifikat, Signatur/Plakette)
- Objekte, Teller, Skulpturen & Reliefs
- Begehrt am Sammlermarkt bei Vollständigkeit/Originalbeilagen
Wandobjekte & Reliefs
- Reliefierte/strukturierte Wandplatten
- Glasur-/Biskuit-Varianten
- Künstlerische Signaturen/Marken
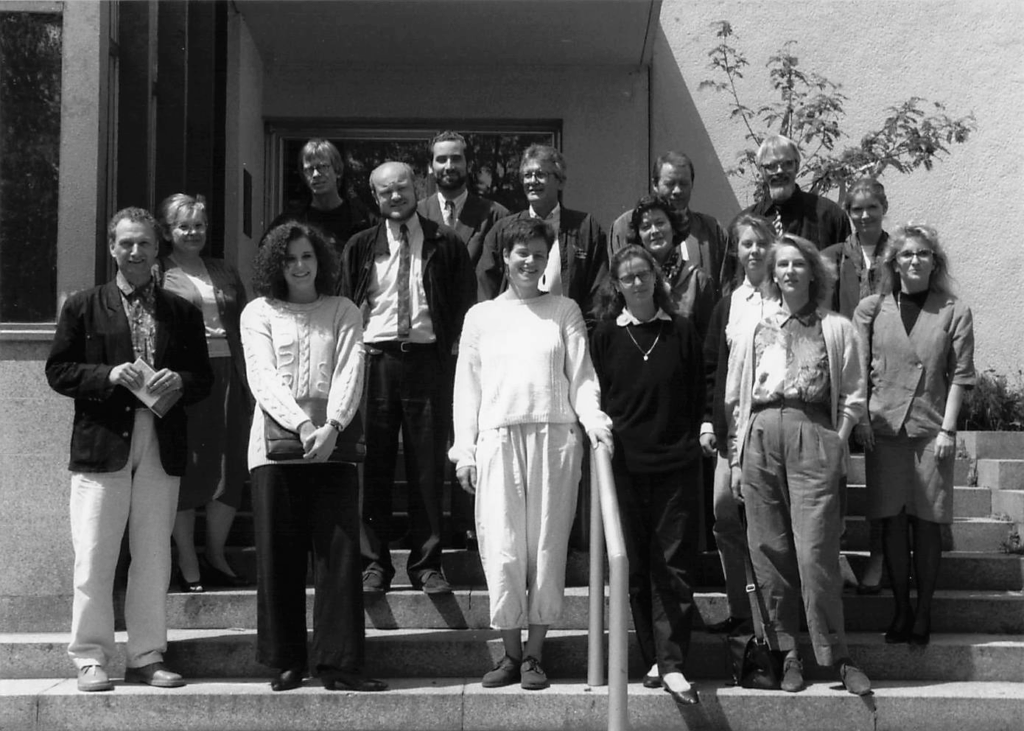
Rosenthal Keramik
Im Jahr 1965 wagte die Rosenthal AG den Schritt in die Fertigung von Keramik. Der Anfang war bescheiden: Die gesamte Belegschaft bestand lediglich aus drei Personen – einem Ingenieur, der zugleich als Betriebsleiter fungierte, einem Dreher und einem Maler.
Bereits nach nur sechs Monaten entstand nach Entwürfen des dänischen Designers Bjørn Wiinblad die erste Keramik-Kollektion. Diese Serie war ursprünglich nur für einen kleineren Kreis von Liebhabern gedacht.
Entwicklung & Durchbruch
Den entscheidenden Durchbruch brachte die Präsentation auf der Hannover-Messe 1966. Dort wurde die Kollektion erstmals einem größeren Publikum aus Fachhandel, Presse und Fernsehen vorgestellt. Der Erfolg übertraf alle Erwartungen: Die gesamte Produktion war für ein Jahr im Voraus ausgebucht.
Aus dem zunächst als Experiment gedachten Projekt entwickelte sich nun ein ernstzunehmender Geschäftszweig, der eine rationelle Serienfertigung und die Erweiterung des Personals erforderte.
Gestaltung & Künstler
Zur Hannover-Messe 1967 präsentierte das erweiterte Keramiker-Team bereits neue Arbeiten. Besonders hervorzuheben waren die Wandplatten von Renate Rhein, die das bestehende Wiinblad-Sortiment ergänzten.
Die künstlerische Vielfalt und die Verbindung von traditioneller Handarbeit mit neuen Ideen gaben der Rosenthal-Keramik eine unverwechselbare Identität.
Technische Entwicklung & Serienfertigung
In den folgenden Jahren wuchs die Werkstatt kontinuierlich. Bald arbeiteten rund 50 Mitarbeiter in der Rosenthal-Keramikabteilung. Die Produktionskapazität stieg stetig, und wo zuvor nur einige wenige Kammeröfen standen, wurden nun moderne, leistungsfähige Tunnelöfen eingesetzt.
Trotz dieser technischen Fortschritte blieb die Töpferscheibe als klassisches Werkzeug unverzichtbar. Sie garantierte den künstlerisch-handwerklichen Charakter und den Manufaktur-Gedanken.
Rezeption & Bedeutung
Die Rosenthal-Keramik entwickelte sich in kurzer Zeit von einem kleinen Experiment zu einer international anerkannten Manufaktur. Die Verbindung von moderner Technik und handwerklicher Tradition verlieh den Objekten eine besondere Authentizität.
Mit diesem Schritt bewies Rosenthal einmal mehr die Fähigkeit, Design, Kunst und industrielle Fertigung in Einklang zu bringen.
Literatur & Quellen
Archiv Rosenthal AG: Dokumente zur Einführung der Keramikproduktion (1965–1970). Zeitzeugenberichte und Messeunterlagen zur Hannover-Messe 1966 und 1967. Entwurfsdokumentationen von Bjørn Wiinblad und Renate Rhein.
Timeline – Rosenthal und die Fertigung von Keramik
Vom kleinen Experiment zur etablierten Manufaktur
Keramik und Porzellan – Grundlagen und Unterschiede
Porzellan gilt als das edelste Erzeugnis der großen Warengruppe Keramik. Das Wort „Keramik“ stammt vom griechischen Substantiv keramos, das ursprünglich „Ton“ bedeutet und auf alle daraus hergestellten Produkte verweist: Krüge, Ziegel, Dachziegel, Wandplatten oder Bodenfliesen. Keramik ist so alt wie die menschliche Kultur und war in nahezu allen Hochkulturen ein fester Bestandteil des Alltags – vom Löwentor in Babylon über Vorratsgefäße im antiken Griechenland bis zu Majolika-Fliesen des Islams.
Materialien und Unterschiede
Keramik umfasst alle Produkte, deren Hauptbestandteil Ton ist. Der wesentliche Unterschied zu Porzellan liegt in der Zusammensetzung: Während Keramik nicht transparent ist, besteht Hartporzellan aus Kaolin, Feldspat und Quarz und besitzt einen lichtdurchlässigen Scherben. Feinkeramische Produkte umfassen Töpferwaren, Majolika, Fayence, Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Bone China und Porzellan. Hartporzellan wird bei Temperaturen bis zu 1400 °C gebrannt, während Feinsteinzeug bei ca. 1200 °C gesintert wird und dadurch wasserdicht, aber nicht lichtdurchlässig ist.
Herstellung und Verarbeitung
Die Herstellung von Feinsteinzeug, wie es etwa bei Rosenthal produziert wird, erfordert komplexe Arbeitsformen wie Einformen, Überformen und Gießen. Auch kompliziert geformte Artikel können im Pressverfahren hergestellt werden. Ein besonderes ästhetisches Reizmittel bieten Produkte aus schamottierter Steinzeugmasse: ihre bräunliche Farbigkeit und griffige Struktur lassen Dekorelemente auch unglasiert wirken.
Reliefs entstehen bereits im Gipsmodell oder werden bei handwerklicher Fertigung frei von Hand geformt. Nach dem ersten Brand bei ca. 900 °C folgt entweder das Glasieren oder das Bemalen mit Unterglasurfarben, die anschließend mit einer transparenten Glasur überzogen werden. Der zweite Brand bei 1200 °C macht den Scherben wasserdicht und bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für farbige Unterglasurdekorierungen. Porzellan hingegen wird erst bei 1400 °C gebrannt, wodurch die Farbpalette eingeschränkter ist.
Glasuren und Brenntechniken
Die Glasuren verleihen Keramik ihren charakteristischen Ausdruck. Glasuren können Metalloxide enthalten, die je nach Konzentration und Ofenatmosphäre intensive Farben erzeugen. Im Oxidationsbrand (sauerstoffgesättigte Atmosphäre) erscheinen Metalloxide in ihren typischen Oxidfarben, z. B. Kupfer in Grün. Im Reduktionsbrand (Sauerstoffmangel) verwandeln sich die Oxide zurück in Metallfarben, z. B. Kupfer in Rot.
Besonders reizvoll ist das Eintauchen von Stücken in unterschiedlich konzentrierte Glasuren, wodurch jedes Objekt einen einzigartigen Charakter erhält. Feinsteinzeug eignet sich zudem für den Mikrowellengebrauch und ist spülmaschinenfest, während Porzellan vor allem durch seine Lichtdurchlässigkeit und edle Oberfläche hervorsticht.
Eigenschaften und Besonderheiten
Feinsteinzeug zeichnet sich durch seinen starken, hartgebrannten Scherben aus. Es ist außergewöhnlich schlagfest, spülmaschinengeeignet und verträgt auch starke Stöße. Eine Besonderheit liegt in seiner Fähigkeit, Wärme länger zu speichern als dünnwandiges Porzellan. So bleibt der Inhalt von Tassen und Schüsseln lange heiß, während die Außenwand nicht zu heiß zum Anfassen wird. Diese Eigenschaft macht Keramikgeschirr besonders beliebt für Teekultur in England, wo die gute Wärmespeicherung als Voraussetzung für die volle Entfaltung des Aromas geschätzt wird.
Steingut und Töpferware werden bei Temperaturen zwischen 950 °C und 1100 °C gebrannt. Ihr Glasurbrand erfolgt bei niedrigeren Temperaturen als bei Porzellan, wodurch die Farbpalette an Glasuren nahezu unbegrenzt ist. Im Gegensatz zu Feinsteinzeug bleibt Steingut jedoch porös: Wenn die Glasur beschädigt wird, können Flüssigkeiten in den Scherben eindringen.
Fazit
Keramik und Porzellan sind seit Jahrtausenden fester Bestandteil menschlicher Kultur. Während Keramik in vielfältigen Formen des täglichen Gebrauchs und Bauens Anwendung fand, gilt Porzellan als die edelste und technisch anspruchsvollste Variante. Unterschiedliche Rohstoffe, Glasuren und Brenntechniken verleihen jedem Objekt seinen individuellen Charakter – von robustem Steinzeug bis zu feinstem, lichtdurchlässigem Porzellan. Feinsteinzeug hat sich als besonders widerstandsfähiges, alltagstaugliches Material etabliert, das durch seine Wärmespeicherung, Vielseitigkeit und dekorativen Möglichkeiten überzeugt.